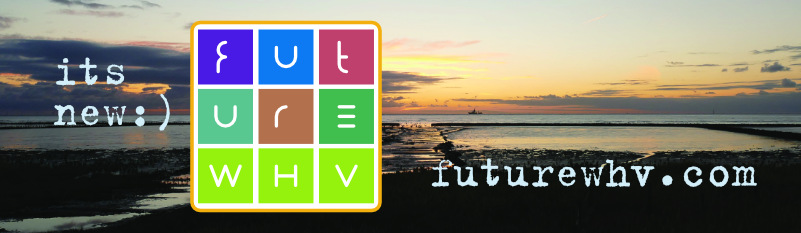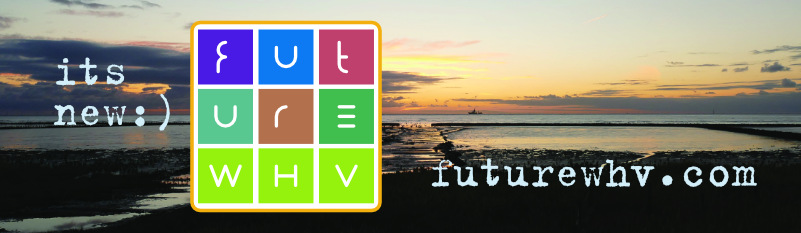Seit 24-03-2022 online:
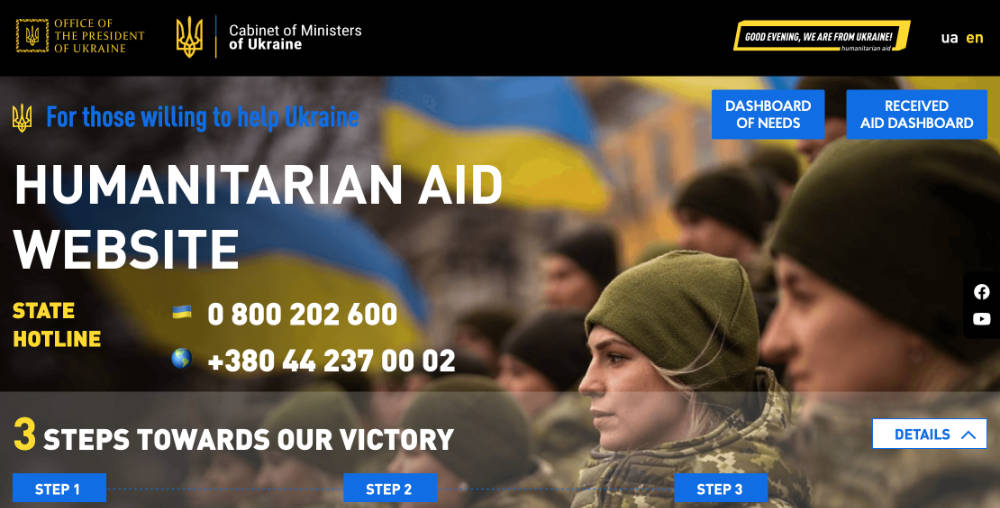
Zur Webside (https://help.gov.ua/): [Hilfe für die Ukraine]
Das LINKE Trauerspiel
30|05|2012

Die Ziele der LINKEN sind nur noch schwer auszumachen, zu vordergründig ist der innerparteiliche Hirarchiestreit.
Personalquerelen statt offener Debatte
Worüber sonst keine Bundestagspartei redet, darüber redet die LINKE, darüber hat sie geredet: Die Militarisierung der deutschen Außenpolitik und die fortschreitende Aufspaltung der Gesellschaft in arm und reich. Genau hier liegt das Verdienst einer Partei, deren Bestand gefährdet ist.
Wird die Linkspartei nach den nächsten Wahlen den Bundestag mangels Wählerzustimmung verlassen, wird die politische Debatte in der Bundesrepublik noch ärmer werden als sie es ohnehin schon ist. Denn der öffentliche Diskurs ist - einer Demokratie scheinbar angemessen - auf das Parlament fixiert: Was dort besprochen oder nicht besprochen wird, das bestimmt die politischen Texte der Medien und deren Inhalte wiederum setzten die Themen dessen, worüber die Deutschen politisieren. Wenn die Linkspartei in die parlamentarische Bedeutungslosigkeit fällt, zerfällt sie. Denn genau dort, wo ihre Stärke lag, den Parlamenten eine eigene, eine alternative Position hinzuzufügen, liegt ihre Hauptschwäche: Die LINKE ist eine Parlamentspartei. Außerhalb der Parlamente existiert sie nahezu nicht.
Sieht man von der Modeerscheinung der Piratenpartei ab, verfügen alle anderen Parteien über gewachsene außerparlamentarische Milieus. Nirgendwo wird das deutlicher als bei den GRÜNEN, die als Partei aus einer außerparlamentarischen Bewegung entstanden ist. Vor und neben der Partei existierten die Kämpfe gegen die Atomkraftwerke und für eine friedliche Bundesrepublik, und noch heute, wo das AKW-Thema scheinbar erledigt ist und die GRÜNEN längst zur Kriegspartei geworden sind, wählt das aus den Bewegungen entstandene grüne Milieu "seine" Partei. Das "C" im Namen der CDU-CSU ist nur scheinbar dem Säkularen gewichen. Immer noch existieren die christlich dominierten Schützen- und Heimat-Vereine, in denen und um die herum die CDU sich organisiert, aus denen sie Wähler und Nachwuchs schöpft. Auch in den Städten, in denen der Brauchtumsreflex geringer geworden ist, versammelt sich die bürgerliche Wohlanständigkeit immer noch rund um die CDU. Trotz des langsamen Zerfalls der Arbeiterbewegung kann auch die SPD über Milieus außerhalb der Parlamente verfügen. Ob in den Gewerkschaftsbüros oder den Vorständen der Kleingartenvereine: Nirgendwo wird man mehr SPD-Parteibücher finden als eben dort. Dass die Zustimmung zur FPD extremen Schwankungen unterliegt, hat auch damit zu tun, dass Rechtsanwälte, Ärzte und Steuerberater außer dem Wunsch besser zu verdienen, wenig eint.
Die Linkspartei, anfänglich aus den Resten der SED entstanden, war von Beginn an ein Parlaments-Verein. Sie stützte und stützt sich bis heute im Osten auf das Netz jener Genossen, die sich auch schon zur DDR-Zeit um "ihre Menschen" gekümmert haben. Und wo früher Versorgungsfragen im Mittelpunkt standen, war es nach dem Verschwinden der DDR der Verlust von Arbeit und Heimat, der von den Abgeordneten der PDS in den Parlamenten vertreten wurde, war es das Kümmern um jene, die Opfer der neuen Wirklichkeit geworden waren, bis hin zur Hilfe beim Ausfüllen jener Formulare, die von den Ämtern für die Verwaltung der Arbeitslosigkeit benötigt wurden und werden. Weil die Gewerkschaften der DDR als Transmissionsriemen der herrschenden Partei benutzt worden waren, gab es keine nennenswerten Strukturen der Arbeiterbewegung mehr. Auch andere außerparlamentarische Organisationen der DDR - von denen der Frauen bis hin zu unterschiedlichen kulturellen Vereinigungen - waren über Jahrzehnte für den Machterhalt der SED formiert worden. Sie verschwanden mit der einst herrschenden Partei in der Bedeutungslosigkeit.
Die Ausdehnung der PDS auf das gesamte Bundesgebiet stützte sich wesentlich auf die Vereinigung mit der WASG, die ausdrücklich als "Wahlalternative" begonnen hatte, und in der sich, neben versprengten Linken aus unterschiedlichen Zirkeln und Lagern, zumeist enttäuschte Sozialdemokraten sammelten. Die Gründung des Wahlvereins galt weniger der Reanimation der Gewerkschaften, der Arbeiter- oder der Friedensbewegung, sondern dem parlamentarischen Kampf gegen eine Sozialdemokratie, die sich mit der Agenda 2010 von ihren sozialen Positionen weitgehend verabschiedet hatte. Man traf sich in der neuen, gemeinsamen Partei, in der fast ausschließlichen Orientierung auf die Parlamente und war nicht fähig, vielleicht gar nicht willens, ein eigenes Milieu zu schaffen. Neben der Parlamentsfixierung krankte und krankt die Partei bis heute an einem sanktionierten Fraktionswesen: In einer Vielzahl von Strömungen grenzen sich Gruppen von Parteimitgliedern eher voneinander ab, als dass sie sich einander zuwenden. Das mag aus der Selbstfindung einer noch jungen Partei zu erklären sein. Doch wer gehofft hatte, mit der Verabschiedung eines lange diskutierten Parteiprogramms, dem immerhin 95,81 Prozent der Mitglieder zustimmten, wäre der Prozess innerparteilicher Kämpfe beendet oder zumindest gemildert, sah sich enttäuscht.
Denn es war ausgerechnet ein Repräsentant jenes Parteiflügels, der stärker auf Regierungsbeteiligungen setzt als andere, der die innerparteiliche Diskussion nach der Verabschiedung des Programms erneut eröffnete. Der stellvertretende Chef der Bundestagsfraktion Dietmar Bartsch, der vom Medienmainstream gern als vernünftiger Praktiker gegen die "wirren, antikapitalistischen Ideologen" ausgespielt wird, stellte mit seiner Kandidatur für den Parteivorsitz zugleich das neue Programm infrage, das jetzt mal "auf seine Politikfähigkeit getestet" werden müsse und verlangte zugleich von seiner Partei einen "Aufbruch".
Schon seit geraumer Zeit dudelt das deutsche Medienklavier die Melodie von den praktischen, reformfähigen Realos in der Linkspartei, mit denen SPD und GRÜNE Koalitionen eingehen könnten und den marxistischen Fundamentalisten, die außerhalb der Wirklichkeit lebten und deshalb auszugrenzen seien. Wer sich an die Anfänge der GRÜNEN erinnert, der kennt das Spiel: Die Realos bekamen damals die Talkshows und die Kommentarspalten, bis sich auch die Fundis, anfänglich zähneknirschend, später lächelnd, dem neuen, praktischen Kurs anschlossen, der gradewegs nach Afghanistan führte.
Und während die grüne Partei zunehmend über parlamentarische Koalitionen und Posten verhandelte - auch solche mit der CDU wollte man nicht ausschließen - zerbröselte die Friedensbewegung, wurde die Distanz zur Anti-AKW-Bewegung immer größer, verkam das grüne Milieu zur Stimmenbeschaffungsmaschine.
Dass die Linkspartei auf ihre wirre Personal-Lage mit immer neuen Personalvorschlägen antwortet, zeigt das Dilemma einer Parlamentsfixierung, die glaubt, man müsse nur ordentliche Personen an die Spitze von was auch immer stellen, dann käme die Partei und mit ihr das Land endlich nach vorne. Wer die Kandidaturen inhaltlich abklopft, stösst auf viel Einheits-Beschwörungen und wenig Inhalt. Die Kandidatin Dora Heyenn aus Hamburg zum Beispiel, begründet ihre Kandidatur mit dem Satz: "Ich gehöre keiner der Strömungen innerhalb der Partei an und bin daher in die Grabenkämpfe nicht eingebunden". Der einzige Inhalt, der auftaucht ist in einem Satz gefasst: "Wir müssen Pluralität ausleben." Gibt es denn kein beschlossenes linkes Programm? Ist "Pluralität" inhaltliche Beliebigkeit?
Die gemeinsame Erklärung der Kandidatur von Katja Kipping [Ost] und Katharina Schwabedissen [West] erhebt die "unterschiedlichen Meinungen" der beiden gradezu zum Programm. Als gäbe es nicht bereits eins. Und dann verkünden sie, darin Bartsch ähnlich, einen "Aufbruch", der aber "in Richtung einer neuen, nicht-autoritären Linken" gehen soll. Wären die beiden wenigsten so freundlich mal Ross und Reiter zu nennen, zu erklären, wer die autoritären Linken sind und was sie inhaltlich anrichten, man hätte sich mit ihrer Kandidatur auseinandersetzen können. Sabine Zimmermann, sächsische Bundestagsabgeordnete und weitere Kandidatin für den Parteivorsitz, wünscht immerhin "das Erfurter Programm unserer Partei zur politischen Praxis werden zu lassen". Darüber, wer denn an den "unwürdigen innerparteilichen Querelen" Schuld trägt, die sie beklagt: Kein Wort. Das passt prima zum Beinahe-Parteivorsitzenden Lafontaine, der seine Wahl exklusiv, ohne Gegenkandidaten haben wollte, ohne das politisch zu begründen. Die Zahl der Vorsitz-Prätendenten wächst, von der LINKS-Vernunft kann man das nicht behaupten.
Während das europäische Wirtschaftsmobil zielstrebig gegen den Baum rast, während die Welt am Vorabend eines Iran-Krieges steht, der gute Chancen hat zu einem Weltenbrand zu werden, personalisiert die Linkspartei ihre inhaltlichen Auseinandersetzung statt sie auszusprechen, lähmt sie sich selbst statt die notwendigen politischen und sozialen Bewegungen zu befeuern. Wenn die LINKE sich nicht besinnt, wird der zynische Satz von Dietmar Bartsch, der ihm während einer Diskussion im November letzten Jahres entglitten war, doch noch wahr werden: Da in Zeiten schlechter Wahlergebnisse die Mandate knapper seien, würden sich die Abgeordneten der Linkspartei um die Posten streiten wie "die Hartz-Vierer um den Alkohol". Das wäre, angesichts der politischen Probleme, nicht nur für die LINKE, auch für die Linken ein Trauerspiel.
Uli Gellermann
Quelle: Rationalgalerie
Sie möchten diesen Artikel
kommentieren? - Kein Problem:
Hier klicken, Artikelstichwort angeben
und Kommentar über das Kontaktformular an die
Redaktion senden!
Vielen Dank!
Startseite/Aktuell |
Kontakt |
Links |
Termine |
Impressum |
Karikaturen |
Fiktive Interviews|
Schicken Sie uns Ihre Leserbriefe |
Archiv |
Spenden |
Leserbriefe |
Newsletter |
|